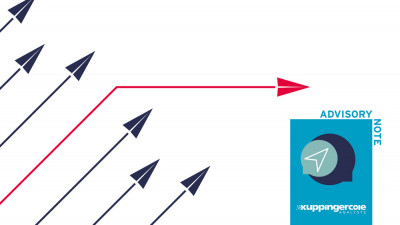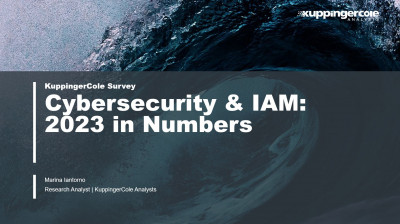Wie im wahren Leben bekommt auch im Internet keiner etwas geschenkt. Smartphone- und Internet-Nutzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass auch kostenlose Dienste und Apps ihren Preis haben. Doch kaum einer kann einschätzen, welchen Wert die übermittelten Informationen wirklich haben.
In einer Studie analysierte das Juniper Networks Mobile Threat Center, inwieweit mobile Apps erweiterte und sensitive Geräte-Funktionen wie das Standort-Tracking oder die Kamera nutzen. Wenig überraschend wurde dabei deutlich, dass vor allem kostenlose Apps auf derartige Funktionen zurückgreifen.
Die Studie zeigt: Wer nicht mit Geld zahlt, muss seine Rechnung in einer anderen Währung begleichen. Die Untersuchung von Juniper Networks wurde 2011/2012 im Google-Play-Markt durchgeführt. Auch wenn damit nur ein Ausschnitt des Gesamtmarkts für Apps beleuchtet wurde, gibt es ausreichend Hinweise, dass sich die Grundaussagen generalisieren lassen.
Der Anteil der Apps, die Tracking-Funktionen nutzen, ist bei kostenlosen Apps beispielsweise rund vier Mal so hoch wie bei kostenpflichtigen. Mehr als drei Mal so viele Gratis-Apps wollen Zugriff auf das Adressbuch des Benutzers. Auch bei Funktionen wie dem Zugriff auf Kameras, die Möglichkeit zum Versenden von SMS oder Anrufen ohne Eingriff des Benutzers gibt es massive Unterschiede – kostenlose Apps tendieren generell dazu, mehr solcher Funktionen zu nutzen.
Das gleiche Bild zeigt sich bei anderen Diensten im Internet. Facebook und Google stehen – völlig zu Recht – hinsichtlich des Datenschutzes in der Kritik. Die Liste lässt sich fast beliebig fortsetzen. Auch wenn Ausnahmen die Regel bestätigen, gilt doch: Kostenlose Dienste sind deutlich kritischer in Bezug auf die Nutzung von persönlichen Daten zu sehen als kostenpflichtige Dienste.
Jedes Unternehmen hat wirtschaftliche Interessen
Das ist allerdings auch keine wirkliche Überraschung, denn die Anbieter benötigen irgendein Geschäftsmodell. Wenn dieses nicht auf einmaligen Zahlungen, auf Abonnements oder auf einem Pay-Per-Use-Modell basiert, wenn also kein Geld fließt, dann muss halt eine andere Währung herhalten. Diese Währung sind die Informationen über den Benutzer.
Einfach gesagt: Es gibt kaum kostenlose Dienste und Apps im Internet. Die Frage ist nicht, ob man bezahlt – die Frage ist, in welcher Währung man bezahlt. Hinsichtlich der persönlichen Informationen gibt es dabei aber zwei Probleme: Zum einen ist oft nicht klar, dass man in dieser Währung bezahlt. Zum anderen kennt man den genauen Preis nicht.
Weitreichender Mangel an Transparenz
Ob bei Apps oder Internet-Diensten: in vielen Fällen wird nicht oder nur unzureichend darauf hingewiesen, ob und welche Informationen gesammelt werden. Das ist kritisch, weil damit dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird. Dabei besteht auf Seiten vieler Anbieter offensichtlich wenig Interesse, diese Offenheit zu schaffen.
Um die Frage zu klären, welchen Preis man für Gratis-Angebote zahlt, muss man wissen, was mit den gesammelten Informationen geschieht. Wer nutzt diese Daten? An wen werden sie weitergegeben? Wie werden sie mit anderen Informationen verknüpft? In diesem Bereich ist man vom beispielsweise in Deutschland geltenden Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung meilenweit entfernt.
Das heißt nun aber nicht unbedingt, dass man die Bezahlung mit der Währung „Information“ verbieten muss. Die Entscheidung darüber, in welcher Währung man bezahlten möchte, kann man grundsätzlich jedem selbst überlassen. Das Problem ist aber, dass sich viele Nutzer dieser Entscheidung nicht bewusst sind, weil nicht oder nicht ausreichend darüber informiert wird, welche Daten gesammelt und wie sie genutzt werden.
Mehr Kontrolle für Anwender und Unternehmen
Der Benutzer sollte dazu in der Lage sein, bewusste Entscheidungen treffen und umsetzen zu können. So gesehen ist die DNT-Thematik („do not track“ als Einstellung im Browser, die von Websites befolgt werden muss, positiv zu sehen, weil sie die informationelle Selbstbestimmung stärkt.
Eine mögliche Folge ist, dass sich dadurch Geschäftsmodelle verändern können und vielleicht weniger kostenlose (genauer: nicht in Geld zu bezahlende) Dienste verfügbar werden. Das ist aber nicht grundsätzlich problematisch und stellt letztlich nur einen Übergang von indirekter zu direkter Bezahlung dar – nicht mehr der Werbetreibende oder andere Informationsnutzer zahlen, sondern der Nutzer des Dienstes selbst.
Für Unternehmen haben Statistiken wie die aktuelle von Juniper Networks allerdings noch eine weitere wichtige Bedeutung: Da es sich bei den von „kostenlosen“ Apps und Diensten gesammelten Informationen auch um geschäftlich relevante Informationen handeln kann, ist die Nutzung solcher Apps und Dienste auch unter rechtlichen Aspekten kritischer und genau zu prüfen.
Generell bestätigt die Untersuchung aber vor allem einmal mehr die These: „There is no such thing as a free lunch“ – alles hat seinen Preis. Und wenn man nicht mit Geld bezahlt, dann eben in einer anderen Währung.